Kyiv: Kriegsverbrechen als Wimmelbild
„Ich muss morgen nach Kyiv, kommst du mit?“ – fragt mich ein Unternehmer, der seit dreißig Jahren gepanzerte Fahrzeuge entwickelt, baut und vertreibt. Etwas spontan, aber warum nicht?
Am nächsten Morgen war alles gepackt und wir saßen im Auto Richtung Ukraine. Dabei machte die Kleidung den geringsten Teil des Gepäcks aus. Der Großteil waren schusssichere Westen und Helme für uns sowie für Kollegen vor Ort die, warum auch immer, ohne ausreichendes Equipment angereist waren. Nach dem Abwägen der Optionen entschieden wir uns, mit dem Auto zu fahren. Die Taschen und Koffer füllten den Bereich bis hinter die vorderen Sitze. Von Berlin aus sollte es elf Stunden dauern, bis wir Lwiw in der Ukraine erreichen. Der Weg war bis zur polnisch-ukrainischen Grenze wenig ereignisreich. Dort gab es nur eine kurze Schlange für private PKW. Außer uns waren einige weitere Presse-Fahrzeuge sowie diverse Fahrzeuge von Rettungsdiensten zu sehen.
In der Gegenrichtung sahen wir permanent kleine Gruppen von flüchtenden Personen. Meist Mütter mit ihren Kindern. Die ukrainischen Grenzschützer brachten sie bis zur eigentlichen Grenze, dort wurden sie von polnischen Kollegen übernommen und mit Suppe versorgt, bis sie den Shuttlebus nehmen konnten, welcher sie weiter brachte. Ein älterer Herr, welcher Probleme beim Laufen hatte, wurde von einer ukrainischen Grenzschützerin gestützt, bis sie ihn an einen polnischen Kollegen übergeben konnte, welcher ihm weiter half. Traurig zu sehen, wie dieser alte Mann alleine fliehen muss. Gut zu sehen, dass ihm Menschen so helfen.

Der Grenzübertritt besteht aus der Ausreise aus Polen, der Passkontrolle und der Zollkontrolle in der Ukraine. Die Ausreise war unproblematisch, bei der Einreise wurden unsere Ausweise genau geprüft und das Gepäck einer Sichtprüfung unterzogen. Alles in allem waren wir nach einer Stunde eingereist, was für eine solche Situation schnell ist. Um 21:30 Uhr erreichten wir unser Hotel in Lwiw, nur 30 Minuten vor der Ausgangssperre, welche bis sechs Uhr morgens ging.
Bereits vor der Einreise hatten wir uns die App installiert, welche uns vor Luftangriffen warnen sollte. Diese ging auch los, als wir das Zimmer betraten. Die Sirenen in der Stadt heulten los. Doch es schien niemanden zu stören. Niemand rannte aus seinem Zimmer, keine Bewegung auf den Straßen. Man gewöhnt sich eben an alles. So blieben wir auch im Zimmer und bewegten uns nicht in den Schutzraum.

Sollte jedoch ein Angriff erfolgen, hat man wenig Zeit zu reagieren. Also schlafen wir komplett angezogen und wägten ab, ob wir mit Schuhen schlafen sollten, oder nicht. Rückblickend war dies in Lwiw überhaupt nicht nötig. Aber in anderen Kriegsgebieten, in denen wir waren, waren es die entscheidenden Sekunden, um rechtzeitig im Schutzraum zu sein. Weste und Helm standen so griffbereit, dass wir sie beim rausrennen greifen konnten. Das medizinische Equipment ist an der Weste befestigt. Es gibt dort keine Bunker. Man rennt einfach in den Keller. Diese bieten keinen Schutz vor einem Volltreffer, aber vor Trümmerteilen und zerberstenden Fenstern.
Lwiw

Lwiw selber ist eine wunderschöne Stadt mit kleinen Gassen, schönen Cafés, kleinen Läden und großen Shopping-Ketten. Jugendliche machen Selfies mit ihren exotischen Kaffee-Variationen, ältere Menschen stehen zusammen und tratschen über den Alltag, ein Touristenführer versucht seine Touren anzubieten.
Ohne die omnipräsenten Befestigungen von Gebäuden und Sandsack-Barrikaden auf den Straßen könnte es eine ganz normale Stadt sein. Doch auch an die Panzersperren, Soldaten und lokalen Zivilverteidigungseinheiten gewöhnt man sich schnell. Die Normalität überwiegt im Straßenbild.

Mitten in der Fußgängerzone gibt es eine Freiluftausstellung, die den verschleppten und ermordeten Journalistinnen und Journalisten gewidmet ist. Man sieht wieder, wie wichtig die Öffentlichkeit für die Opfer des Krieges ist.

Ein paar Orte weiter gibt es eine improvisierte Werkstatt, welche schusssichere Westen aus Kriegsbeute baut. Sie zerlegen erbeutete russische LKW, die an der Hinterachse über Blattfedern verfügen. Diese Blattfedern werden in gleich lange Stücke zersägt und zu 25x30cm Platten zusammengeschweißt – das gängige Format für die Schutzplatten in den Westen. Sie ließen diese Platten von Soldaten zum Test beschießen – und sie hielten. Hier ist der Krieg auf einmal ganz nah.
Lwiw nach Kyiv

Der Fahrt von Lwiw nach Kyiv ging einer längeren Planung der Route voran. Ortskundige Fahrer gaben uns genaue Anweisungen, wie und über welche Routen, durch welche Orte und über welche Checkpoints wir fahren sollten und wann wir tanken müssen. Ein kompliziertes Unterfangen, was mit einem Plan endete, der an das Roadbook eines Rallyefahrers erinnert. „Ihr werdet mindestens zehn Stunden brauchen und um 21 Uhr ist Lockdown. Fahrt also spätestens um 10 Uhr los.“
Wir hielten uns an die Vorgaben, starteten früh und fuhren mit genug Benzin im Tank und im Kanister, um im Notfall ohne Stopp an einer Tankstelle durchfahren zu können. Die Straße war je Richtung mal einspurig, mal zweispurig. Je weiter wir Richtung Kyiv kamen, desto dünner wurde der Verkehr. Ab dem Ort Zhytomir sollten wir dem Roadbook folgen. Doch wir sprachen vor Ort die Soldaten an, die uns sagten, wir könnten auch dem Highway E40 folgen, also der kurzen und direkten Route. „Ihr seid die Ersten, die hier durchfahren. Die Straße war bis gestern umkämpft. Also seid vorsichtig und hört auf die Kollegen. Fasst nichts an, hier können noch Sprengfallen sein. Alles Gute!“ erklärte uns der Soldaten am Anfang.
Wir ließen uns auf den kurzen und schnelle Weg ein, zogen aber zur Sicherheit die schusssicheren Westen und Helme an. Die ukrainischen Sicherheitskräfte kontrollierten unsere Ausweise an einigen Checkpoints und lotsten uns durch die Trümmer und an den gefährlichen Stellen vorbei, wünschten uns alles Gute und erklärten, welche Bereiche sicher seien und welche nicht.

Das, was in den kommenden Stunden folgte, erinnerte an das Hollywood-Set dystopischer Spielfilme. Auf der Strecke begegneten wir langen Konvois des ukrainisches Militärs, die schweres Gerät verlegten. Die Soldaten saßen oft auf Panzern oder fuhren mit zerschossenen, privaten Fahrzeugen. Teilweise konnte man sich kaum vorstellen, dass diese Wagen noch fahrbereit waren.

Es folgten zerstörte Brücken und Straßen, von Panzern überrollte Leitplanken, Minen und Leichen. An etlichen Stellen sahen wir die zerstörten zivilen Fahrzeuge. Komplett zerschossen, wie ein Nudelsieb. Dahinter die Leichen von Menschen, welche Schutz suchten, aber ihn hier nicht fanden. Ganz klar Zivilisten.

Auf den von uns aufgenommenen Fotos fanden wir am Abend beim Sichten immer weitere Zeichen für die Gräueltaten der russischen Armee. Kriegsverbrechen als Wimmelbild. Teilweise war die gesamte Straße voller zerstörter Fahrzeuge und Teile von diesen, so dass wir durch das Trümmerfeld oder drum herum fahren mussten.
Sechzig Kilometer vor Kyiv mussten wir warten, bis gefundene Munition gesprengt worden war. An einer Stelle lag das Rohr eines Panzers auf der Autobahn. Eine Kette etwa zwanzig Meter weiter. Den Rest des Panzers lag überschlagen daneben. Im Film würde man an dieser Stelle rausgehen uns sich beschweren, dass es unrealistisch sei. Wie soll ein mehrere zehn Tonnen schwerer Panzer so hoch fliegen? Hier sieht man, dass es geht.

Weiter vor Kyiv, neben dem Ort Butscha, trafen wir langsam auf die nächsten Journalisten, welche aus Kyiv hierher gekommen waren. Ein bizarres Bild, wie Pressevertreter mit Selfiesticks vor zerstörten Fahrzeugen stehen, den besten Winkel für die Leiche und den Panzer suchen, und den Balanceakt zwischen Sicherheit und guten Fotos meistern.
Für Ausstehende mag das abgebrüht und emotionslos wirken, doch für diese Menschen ist es Alltag. Und ihre Aufgabe ist es, eine ganze Situation in einem Bild einzufangen. Sie sorgen dafür, dass Menschen zuhause verstehen, was hier passiert. Dazu gehört eben auch, eine Leiche anzudeuten, ohne die ekeligen Details zu zeigen. Man muss die Kriegsverbrechen hier in die Wohnzimmer in Deutschland bringen, ohne dabei pietätlos zu werden. Ich beneide diese Menschen nicht um ihre Jobs.
Wir mussten weiter, um vor Beginn der Ausgangssperre das Hotel in Kyiv zu erreichen. Kurz nachdem wir durch dieses Gebiet gefahren waren wurde es für zwei Tage für die Durchfahrt gesperrt, damit aufgeräumt werden konnte.
Kyiv

Nach nur sechs Stunden erreichten wir den Checkpoint am Stadtrand Kyiv. „Wie ist das Passwort?“ fragte der Soldat. Wir sahen uns irritiert an. „Passwort!?“ – „Ja! Das Passwort!“, wiederholte er. Wir wussten weiterhin nicht, was wir sagen wollten. „Slawa Ukrajini!“ („Lang lebe die Ukraine!“) – sagte er lachend und winkte uns durch. Es war also schon wieder Zeit für Scherze. Danach wurden wir direkt von einem Luftalarm begrüßt. Jedoch wurde dieser erneut von allen umstehenden ignoriert. Also taten wir es ihnen gleich.
Die Stadt ist gesichert, wie eine mittelalterliche Festung. Panzersperre hinter Panzersperre, Maschinengewehr-Positionen in regelmäßigen Abständen, schweres Baugerät als Straßensperren. Über Kilometer zog sich dieser Verteidigungsring. Auch mit Panzer wäre man hier nicht ohne weiteres durchgekommen, zumal man in den umliegenden Hochhäusern gute Schusspositionen für die panzerbrechenden Raketenwerfer einnehmen kann. Die Straßen waren relativ leer, die meisten Geschäfte geschlossen.
Statuen, welche mehr als zehn Meter hoch sind, wurden mit endlosen Türmen aus Sandsäcken vor Angriffen geschützt. Tagelang hatten Freiwillige die Säcke gefüllt, gestapelt und befestigt. Die Bilder dieser Aktion gingen um die Welt. Man muss nicht nur überleben, sondern auch Kunst und Kultur erhalten.
Die USA hatten gewarnt

Die US-amerikanischen Geheimdienste hatten die Welt mehrmals vor dem kommenden Krieg gewarnt. Dafür haben sie gute Quellen verbrannt. Aber sie hielten es für wichtig, dass alle vorbereitet seien. Die russische Regierung fühlte sich ertappt und startete den Angriff nicht am ursprünglich gewünschten Tag, um die Daten der Amerikaner nicht zu bestätigen. Doch statt diese Leistung der Dienste anzuerkennen, spotteten viele in Deutschland darüber. Die Amerikaner könnten nicht mal das richtige Datum voraussagen.
Gerne wird auch darauf hingewiesen, dass vor Jahrzehnten auf die Massenvernichtungswaffen im Irak hingewiesen wurde, welche es zu dem Zeitpunkt nicht mehr gab. Dies war jedoch keine Information der Dienste, die vor dem Krieg in der Ukraine gewarnt hatten. Und Saddam Hussein hatte Massenvernichtungswaffen, hatte diese eingesetzt und zehntausende Zivilisten getötet. Nur eben früher in Halabdscha. Dennoch war die Genugtuung über die Dienste spotten zu können bei vielen wichtiger, als die Warnung wahrzunehmen.
Inzwischen geben die USA keine solchen Informationen mehr raus. Ihre Quellen waren verbrannt, man machte sich über sie lustig, aber niemand reagierte. Warum sollten sie die Öffentlichkeit also weiter auf dem Laufenden halten?
Journalisten und ihre Hotels

Wir checkten im gleichen Hotel wie die anderen großen Redaktionen ein. Gerade aufgrund der nächtlichen Ausgangssperren ergibt dies Sinn. So kann man die Nächte für Gespräche untereinander nutzen, statt alleine im Zimmer zu liegen. In solchen Gebiete kommen meist zuerst die großen US-Sender an. CNN, Sky, Fox, dicht gefolgt von der britischen BBC. Die ARD ist noch nicht vor Ort.
„Aber Ihr habt ja Ronzheimer, der die Fahne für die Deutschen oben hält!“, meint ein US-Kollege. Gemeint ist Paul Ronzheimer von der Bild, welcher immer als einer der Ersten kommt und als einer der Letzten geht.
Aber auch andere Produktionsgesellschaften, Agenturen und Freelancer treffen sich hier. Die großen US-Sender quartieren sich meist in großen Hotels mit guter Reputation ein. Notstrom, stabiles Internet und ein hohes Dach in zentraler Lage gehören zu den üblichen Anforderungen. Ein Pool ist auch wichtig. Nicht zum Schwimmen, sondern als Wasserspeicher, falls die Wasserversorgung zusammenbricht. Man kann noch wochenlang das Wasser aus dem Pool abkochen und trinken. Die anderen Journalisten gehen dann in das Hotel, in dem bereits viele Kolleginnen und Kollegen sind. Redaktionen mit kleineren Budgets schlafen in den Hotels drumherum und kommen tagsüber herüber.
So ergibt sich oft ein irreführendes Bild von Journalisten, welche im Kriegsgebiet im Luxushotel in der Lobby sitzen und von dort aus arbeiten. Die Szene ist überschaubar groß und sehr freundlich. Egal, wie sehr die Redaktionen im Konkurrenzkampf stehen, oder wie sehr ein Kollege vom heimischen Schreibtisch aus gegen einen anderen gewettert hat: Hier gehen alle freundlich miteinander um. Oft sieht man an den verschiedenen Krisenherden der Welt die selben Gesichter. Man tauscht Kontakte und Informationen aus, warnt sich vor gefährlichen Gegenden, weist auf die guten Cafés hin oder verbringt einfach die Abende miteinander. Grundsätzlich wird man mit offenen Armen empfangen.
So luden uns die Kollegen von CNN direkt ein, ihr Studio zu besuchen und mit den Stars und Urgesteinen der Berichterstattung zu sprechen. Ebenfalls interessant ist der Kontakt zu den Sicherheitsleuten, welche die Journalisten umringen. Ganze Teams von Fahrern, Personenschützern und Lageanalysten teilen sich zu Büros umgebaute Zimmer im Hotel. Auf Reihen von Monitoren und Karten gehen die Informationen ein, wie in einem militärischen Lagezentrum. Es werden verschlüsselte Funkgeräte, Satellitentelefone und Personen- und Fahrzeugtracker genutzt. Auch die Sicherheitsteams der verschiedenen Sender stehen in engem Kontakt. Kein Anzeichen von Konkurrenzkampf. Am Ende haben alle das gleiche Ziel: Ihre Schützlinge sicher nach Hause bringen.

Vor der Tür des Hotels reihen sich die gepanzerten Geländewagen auf. Mittendrin steht Fidelis Cloer, welcher seit dreißig Jahren auch Medienunternehmen mit diesen Fahrzeugen versorgt. Er ist meist zur gleichen Zeit in den gleichen Hotels. Er spricht mit seinen bisherigen und potentiellen Kunden, inspiziert die gelieferten Fahrzeuge und macht sich selbst ein Bild der Lage. Da wir oft aus verschiedenen Gründen die gleichen Ziele haben, reisen wir häufig zusammen in diese Gegenden. Er wird umringt von Sicherheitskräften, welche händeringend Fahrzeuge suchen. „Ich versuche seit Tagen, dich zu erreichen. Gut, dass Du jetzt hier bist!“, sagt ein tätowierter, großer, breiter, bärtiger Mann und schiebt sich zu ihm durch. „Niemand hat uns vorhergesagt, dass der Krieg jetzt los geht. Ich tue, was ich kann“, erwidert Fidelis Cloer lachend, bevor sie sich über die Anforderungen des Unternehmens und die potentiellen Lieferungen unterhalten.
Vom Dach des Hotels aus kann man die ganze Stadt überblicken. „Aber geht da nicht einfach hoch, das macht die Ukrainer nervös“, warnt uns ein Kollege. Man kann vom Dach aus auch auf umliegende Regierungsgebäude gucken oder ausspähen, von wo aus welche Flugabwehr abgefeuert wird. Wichtige Informationen für russische Spione. Gerade in so einem harten und brutalen Krieg wie diesem ist der Spagat zwischen dem Schutz von Informationen und dem Verbieten selbiger sehr kompliziert. Unter Journalisten geht es oft darum, als Erster die am beste recherchierte Story über eine bisher unbekannte Sache zu bringen. Wie ein Wettrennen beim Sport. Der auf dem zweiten Platz ist der erste Verlierer. Auf der anderen Seite gibt es Informationen, welche aus guten Gründen nicht in die Öffentlichkeit gehören.
Werden zum Beispiel Journalisten getötet, so veröffentlicht man deren Identitäten erst, wenn die Familie informiert wurde. Als vor einigen Wochen zwei Journalisten angegriffen und einer von ihnen getötet wurde, wusste sein Kollege das noch nicht, und gab Interviews aus der Notaufnahme. Prompt konnten es einige Kollegen abseits des Geschehens nicht lassen und schrieben ihm öffentlich auf Socialmedia-Plattformen, dass sein Kollege bereits tot sei. Sie wollten einfach „Erster“ rufen zu können, ohne Rücksicht auf das zweite Opfer oder auf die Familie zu nehmen.
Die ukrainische Armee bat darum, nicht in Echtzeit über Truppenbewegungen und ähnliches zu berichten. Das heißt, dass man keine Militärkonvois fotografiert, um sie auf Twitter zu packen und nicht live den Beschuss einer Stadt überträgt, weil man dann aus den Fernsehbildern die Positionen der Flugabwehr erkennen kann. Vor Ort wissen die Leute sowieso, wo welche Flugabwehr steht, wo eine temporäre Kaserne aufgebaut wurde oder warum welche Cruise Missile welches Gebäude traf. Aber man spricht öffentlich nicht darüber.
Nach dem Krieg vermischen sich dann diese Informationen von vor Ort mit Gerüchten und Tratsch. Das Ergebnis nennt man den „Fog of war“, den Nebel des Krieges, in dem Informationen verschwimmen und einige Dinge einfach nie genau ans Licht kommen.
Kyiv jetzt

Läuft man jetzt durch die Straßen der ukrainischen Hauptstadt, so erinnert es an einen Weihnachtsspaziergang in Deutschland. Es schneit sogar, auch wenn der Schnee nicht liegen bleibt. Man trifft auf wenige andere Menschen, welche ziellos durch die Stadt spazieren. Die meisten Geschäfte haben geschlossen. Nur ab und zu hat eine Bar, ein Café oder ein kleiner Lebensmittelladen geöffnet. Es ist sehr ruhig und die meisten Menschen auf der Straße sind Sicherheitskräfte und Journalisten. Auch wenn Putin seine Armee derzeit auf Kramatorsk schickt, gehen viele Analysten vor Ort davon aus, dass ein erneuter Angriff auf Kyiv erfolgen wird.
Putin braucht ein Erfolgserlebnis, welches er am nationalen Gedenktag für den Sieg über das Naziregime am 09. Mai präsentieren kann. „Durchatmen, aber nicht Entspannen“ ist die Devise. Niemand möchte mehr Tipps abgeben, was die kommende Woche bringt. Man könnte die Situation mit Brechts Worten beschreiben: „Wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen. Den Vorhang zu und alle Fragen offen“
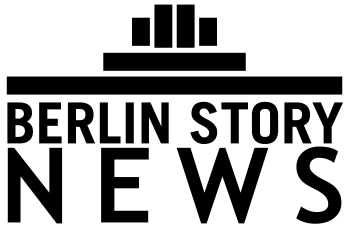















4 Kommentare